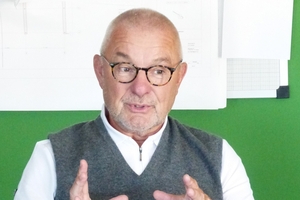Reportage bei der Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG, Dresden
Im nordöstlichen Stadtgebiet von Dresden zwischen Hellerberge und Dresdner Heide ist die Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG (im Weiteren Nordmineral) angesiedelt. Das Unternehmen gehört zum Bereich „Umwelt und Entsorgung“ der familiengeführten, deutschlandweit agierenden AMAND-Unternehmensgruppe in Sachsen, zu denen außerdem die Amand Umwelttechnik Lockwitz GmbH & Co. KG, die Amand Umwelttechnik Grumbach GmbH & Co. KG sowie die Amand Umwelttechnik Rochlitz GmbH & Co. KG gehören. Die Nordmineral betreibt eine Recyclinganlage, in der vor allem mineralische Bauabfälle zu hochwertigen Ersatzbaustoffen aufbereitet werden.
Chefredakteurin Dr. Petra Strunk und Dr. Brigitte Hoffmann erhielten als Vertreterinnen der Redaktion der AT MINERAL PROCESSING die Möglichkeit, die Anlage für eine Werksreportage zu besichtigen. Als Gesprächspartner der Nordmineral gaben der Geschäftsführer Stefan Becker sowie der Betriebsleiter und Prokurist Dipl.-Ing. Knut Seifert Auskunft.
Historie der Recyclinganlage
Das Gelände der Nordmineral befindet sich im Bereich der größten innerstädtischen Sandgrube des ehemaligen Baustoffkombinats der DDR. 1994 erließ die Stadt Dresden eine damals fast revolutionäre Satzung, mit der sie die in der Boomphase des Baus nach dem Mauerfall in großen Mengen anfallenden Bauabfälle für die Abfallerzeuger unter eine sog. „Andienungspflicht“ stellte. Gleichzeitig beauftragte die Stadt vier über das Stadtgebiet verteilte, privatwirtschaftlich betriebene und eigens zu diesem Zweck errichtete Anlagen im Rahmen eines auf 10 Jahre angelegten Vertrages, die Abfälle im Namen der Stadt anzunehmen. Ziel sollte eine maximale Rückgewinnung der enthaltenen Wertstoffe durch Aufbereitung und Rückführung in den Wirtschaftskreislauf sein. Eine der Anlagen entstand am Heller.
Das System funktionierte zwei Jahre lang erfolgreich. Dann erließ der Bundesgesetzgeber das erste Kreislaufwirtschaftsgesetz, das den Kommunen die Möglichkeit nahm, die Bau- und Gewerbeabfälle weiter unter der Andienungspflicht zu halten. Die von der Stadt gebundenen Anlagen standen nun im offenen Wettbewerb, der vor allem aus der Konkurrenz mit Tagebauverfüllungen bestand. Deren Annahmepreise lagen indes so weit unter jenen der Anlagen, dass sich dort alsbald erhebliche wirtschaftliche Probleme zeigten. Im Jahr 2000 warf auch der damalige Betreiber der Anlage am Heller das Handtuch. Unbesehen der zweifellos fortbestehenden Schwierigkeiten glaubte die Amand-Gruppe weiter an die Zukunft des Baustoffrecyclings. Sie fasste die sich bietende Gelegenheit beim Schopf, den Standort Heller zu übernehmen – und betreibt ihn bis zum heutigen Tag.
Technische Historie
Die Aufbereitungsanlage am Standort Hammerweg nahm im Mai 1996 den Betrieb auf. Nach wie vor steht sie dort in konzeptionell nahezu unveränderter Gestalt. Die Klassiker „Zerkleinern, Sieben, Sichten“ bilden immer noch den Kern der Anlage. Geschuldet ist das nicht etwa unternehmerischem Sparkurs, sondern hauptsächlich der Tatsache, dass für die Aufbereitung mineralischer Abfälle in den zurückliegenden dreißig Jahren nichts wesentlich Neues, schon gar nichts revolutionär Innovatives entwickelt wurde. Große Änderungen an der Anlagentechnik waren jedoch auch deshalb kaum notwendig, weil die Anlage von Beginn nahezu alles in hoher Qualität enthielt, was noch heute den „state of the art“ darstellt.
Die Qualität der Anlage ermöglicht es, aus Beton- und Ziegelbruch zertifizierte RC-Splitte in allen gängigen Körnungen herzustellen. Diese Splitte können in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, wie etwa Frischbeton und Flüssigböden.
Splitte aus Beton und Ziegeln setzen Bau und andere Produktionsbetriebe seit jeher gerne ein. Betonsplitte z. B. haben in bestimmten Anwendungen spezifische technische Vorteile gegenüber dem Primärbaustoff Kies. Ziegelsplitte eignen sich u.a. wegen ihrer Fähigkeit zur Wasserspeicherung sehr gut als Bestandteil von Dachsubstraten, die die Nordmineral anwendungsfertig selbst herstellt und verkauft. Gleiches gilt grundsätzlich für eine Reihe von Splitten aus Mischfraktionen. Deren Verwendung leidet aber nach Aussage der Verantwortlichen der Nordmineral aktuell unter der Ersatzbaustoffverordnung. Sie hat die Anforderungen an die Chemie der Splitte spürbar verschärft und zudem neue bürokratische Hürden aufgebaut, die für die Primärbaustoffe nicht gelten.
Bei der Aufbereitung von Betonbruch und gebrauchten Ziegeln entsteht technisch unvermeidbar zwischen 30 und 50 % Sand, für den es bis heute an qualifizierten Einsatzmöglichkeiten mangelt. Die Nordmineral sucht deshalb nach Ideen, was man mit dem Sand anderes anfangen könnte, als ihn irgendwann irgendwo zu verfüllen. Dazu nutzt sie die seit vielen Jahren vor allem von Knut Seifert gepflegten, teils intensiven Beziehungen zu den technischen Universitäten in der Region.
Besonderheiten der Recyclingbaustoffe
In Deutschland wurden 2022 von den rund 208 Mio. t aller mineralischen Bauabfälle 188 Mio. t und damit erstmalig über 90 % einer umweltverträglichen Verwertung zugeführt. Während Bodenaushub (rund 59 % des Gesamtaufkommens) nur zu knapp 87 % verwertet wurden, lag die Verwertungsquote der körnigen mineralischen Bauabfälle, wie Bauschutt und Straßenaufbruch bei knapp 96 %. Die Substitutionsquote der zu Recyclingbaustoffen aufbereiteten körnigen mineralischen Abfälle für primäre Gesteinskörnungen betrug 13,3 % (75,3 Mio. t) [3]. Von diesen Recyclingbaustoffen gingen knapp die Hälfte in den Straßenbau (35,8 Mio. t) und 14,5 Mio. t (19,3 %) in die Beton- und Asphaltproduktion. Eine Quote von 13,3 % mag wenig klingen, jedoch hängt die Substitutionsquote vom Gesamtbedarf an Gesteinskörnungen und dem Abfallaufkommen ab. Es können nicht mehr als 100 % der Abfälle verwerten werden. Dennoch sind die Bemühungen der Bauindustrie im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sinnvoll und notwendig, um höherwertige Recyclingbaustoffe herzustellen und neue Verwertungswege zu finden. In vielen anderen als den genannten Bereichen ist der Einsatz von Recycling-Baustoffen heute schon technisch möglich, wenn die politischen Rahmenbedingungen entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgedanken geschaffen werden. Insbesondere die Qualitäten der Beton- und Ziegel-Recyclate erlauben einen hochwertigen Einsatz dieser Sekundärbaustoffe. Mit welchen Schwierigkeiten sich der Produzent dabei aber auseinandersetzen muss, erläuterte Herr Seifert an eindrucksvollen
Beispielen.
Aber auch in anderen Bereichen ist der Einsatz von RC-Baustoffen technisch möglich, wenn die politischen Rahmenbedingungen entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgedanken geschaffen werden.
Davon sei nur eines genannt. In Dresden wird zurzeit das Halbleiterwerk der Infineon Technologies AG erweitert. Im Zuge des Baugrubenaushubs fielen sechsstellige Kubaturen vor allem an Felsgestein an. Dieses Gestein wollte die Nordmineral aufbereiten, dann sollte es als Zuschlagstoff für den Frischbeton zum Bau der Fundamente des Vorhabens verwendet werden. Im Grunde also ein ideales Beispiel für das Konzept „Aus der Stadt – in der Stadt – für die Stadt“. Unter ökologischen Aspekten zudem vorteilhaft, weil es Transportentfernungen auf ein Fünftel reduziert hätte. Die Stadt vereitelte das, weil der Fels aus der Baugrube allein durch den Aushub rechtlich zu Abfall wird. Dieser „Abfall“ hätte zur Überbrückung des „Timelag“ zwischen Aushub und Wiederverwendung als Zuschlagstoffe zwischengelagert werden müssen. Zwischenlager für Abfall sind genehmigungspflichtig nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz – Zwischenlager für Naturbaustoffe sind es übrigens nicht. Die Stadt war zu einer auch nur temporären Genehmigung nicht bereit.
Sachverhalte wie dieser erklären, warum sowohl der BDE (Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft e. V.) als auch der BRB (Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V.) schon seit Jahren eine proaktive Vorreiterrolle der öffentlichen Hand für die nachhaltige Beschaffung von Ersatz- bzw. Recyclingbaustoffen fordern.
Obwohl die Position politisch im Grunde nicht umstritten ist, hat der Bundesgesetzgeber rechtlich keine Taten folgen lassen, die tatsächlich helfen würden. Die Ersatzbaustoffverordnung (EBV), deren Zustandekommen fast 20 Jahre in Anspruch nahm, trägt bis heute nichts zum vermehrten Einsatz von RC-Baustoffen bei. Im Gegenteil führt ihre vorsichtig formuliert bürokratische Ausgefeiltheit zur massenhaften Flucht aus dem eigentlich beabsichtigten hochwertigen Baustoffrecycling. Der Freistaat Sachsen schuf zwar 2019 mit dem § 10 des neuen sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes eine erfreulich eindeutige Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber zum Einsatz von Recyclingprodukten. Die meisten Verwaltungen ignorieren die Verpflichtung jedoch schlicht; die Gründe dafür sind vor allem formaljuristischer Natur.
Als große Bremse der Verwendung von RC-Baustoffen erweisen sich die Kontrollvorschriften, die die Hersteller berücksichtigen müssen. Hier besteht ein erheblicher Unterschied zwischen Natursteinprodukten und Recyclingbaustoffen. Nur bei letzteren ist der Aufwand für Eignungsnachweise, die Einhaltung der Qualitätsparameter und die detaillierte Dokumentation ihrer Verwendung derart erheblich; bei Natursteinprodukten dagegen ist das alles nicht erforderlich. Bei meist annähernder Preisgleichheit kann es nicht verwundern, dass private wie öffentliche Auftraggeber schlicht den Verwaltungsmehraufwand scheuen, den der Einsatz von RC-Material zwangsläufig mit sich bringt.
Das Ziel: hochwertige Recyclingbaustoffe
Aus gleich einer ganzen Reihe von bei näherem Hinsehen naheliegenden Gründen gewinnt die Idee einer „Regionalen Kreislaufwirtschaft“ in jüngster Zeit zunehmend Befürworter. Stefan Becker prägte dafür den oben schon kurz erwähnten Slogan „Aus der Stadt – in der Stadt – für die Stadt“. Auf die Frage, was das heiße, antwortet er: „Es ist das hoffentlich einprägsame Schlagwort für den simplen Vorschlag, dass die in einer Stadt wie Dresden entstehenden Abfälle auch in der Stadt aufbereitet und die entstehenden RC-Produkte ebenfalls in der Stadt verwendet werden sollen.“ Knut Seifert ergänzt: „Recycling beginnt mit der Überlegung: Kann ich etwas weiter nutzen, oder kann ich es umnutzen. Und dann erst kommt die mehr oder weniger aufwändige Aufbereitung zur Herstellung von Recyclaten.“ Man merkt ihm an und sieht es im Unternehmen, dass dieser Grundgedanke der Kreislaufwirtschaft gelebt wird (z. B. Verwendung der als Bauschutt angelieferten, oft nur leicht beschädigten Betonfertigteile als Absperrsegmente für die Materiallagerung).
Rund 55 000 t/a an qualifizierten mineralischen Recyclingbaustoffen bis hin zu hochwertigen Substraten stellt das Unternehmen am Hammerweg her, das sind Bauschutt-Recyclate, Ziersplitte und Dach- sowie Bodensubstrate. Dazu kommen seit jüngster Zeit Flüssigböden nach RAL GZ 507.
Aufbereitungsverfahren
Der ursprüngliche Betreiber der Anlage hatte seine Wurzeln in der Gewinnung und Verarbeitung von Felsgestein. Auch daraus erklärt sich die massive Bauweise, die nach heutigen Maßstäben in vielerlei Hinsicht (z.B. bezüglich der Energieeffizienz) anders gestaltet würde. Doch gerade diese Bauweise ist ein wesentlicher Grund für die ungewöhnlich lange Lebensdauer.
Eine der genehmigungsrechtlichen Auflagen für die Errichtung der Anlage war die Unterbringung der Maschinenkonfiguration in einer geschlossenen Halle. Die Anlagenteile entsprechen denen einer üblichen Bauschutt-Recyclinganlage. Das angelieferte Material wird zunächst möglichst sortengerecht im Freien gelagert; die Kunden werden angehalten, sortenreines Material anzuliefern. Diese Vorab-Sortierung hat große Bedeutung für die anschließende maschinelle Bearbeitung. Falls notwendig, entnimmt ein Bagger großformatige Fremdbestandteile bzw. Störstoffe. Ein Radlader füllt anschließend das Material in einen Aufgabebunker. Über ein Schwerlastband mit Vorabsiebung und Magnetscheider gelangt das Material in eine Prallmühle, es erfolgt eine erneute Magnetabscheidung und Siebung (Rüttelsiebe). Bei entsprechenden Verschmutzungen kann der Stoffstrom in eine manuelle Sortierkabine mit acht Sortierplätzen umgelenkt werden, wo kleinere Störstoffe aussortiert werden, bevor das Material über einen Elevator zur weiteren Klassierung in ein Dreifach-Sieb mit integriertem Windsichter gelangt. Er dient zur Abtrennung der Leichtfraktion, im Wesentlichen Holz und Fasern. Diese Leichtfraktion kann für die Herstellung von Ersatzbrennstoffen im Amand-Werk Lockwitz verwendet werden.
Knut Seifert weist darauf hin, dass vor allem die verwendete Siebtechnik den größten Unterschied zu dem meisten mobilen Anlagen darstellt und für die Qualität der Endprodukte entscheidend wichtig ist. Sie gewährleistet die sichere Einhaltung der Korngrößen, die die industriellen Anwender verlangen und erwarten.
Die Lagerung der einzelnen Fraktionen erfolgt in Boxen, je nach Material entweder in der Halle oder aber im Freien, und sie stehen dann als RC-Verkaufsprodukte bereit.
Der derzeitige Output der Recyclinganlage liegt bei 120 – 130 t/h, obwohl sie für einen höheren Durchsatz ausgelegt ist. Um diesen ohne Qualitätsverluste zu erreichen, wäre eine Modernisierung der Anlage nötig. Planungen dafür gibt es laut Knut Seifert. Zu ihrer Umsetzung bedürfte es allerdings einer deutlich höheren, nachhaltigen Nachfrage nach Recyclingbaustoffen aus der Bauindustrie.
Flüssigbodenanlage nach RAL 507
In jüngerer Zeit hat das Unternehmen eine Anlage zur Herstellung von Flüssigboden in Betrieb genommen und damit seine Produktpalette erweitert. Bei dem großen Anfall von Bodenaushub, der nach KrWG nicht mehr auf Deponien angelagert werden darf, ist das sog. RSS®-Verfahren [2] besonders interessant, da es eine Wiederverwendung des Abfalls Boden gestattet und dazu Energie und somit Kosten spart. Unter Zusatz verschiedener Compounds wie Bentonit und Zement sowie Prozesswasser wird ein selbstverdichtender, temporär flüssiger Boden hergestellt, der als Verfüllmaterial bei entsprechenden Baumaßnahmen (Einbau erdverlegter Bauteile) eingesetzt wird. Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem FiFB Leipzig zeigten, dass für die Herstellung des Flüssigboden auch die Sande, die beim Recycling von Beton und Ziegeln entstehen, eingesetzt werden können. Damit rentiert sich die Anschaffung der Kompaktanlage Typ 5.2 für die Nordmineral, denn gerade die Sande sind die Fraktionen, die schwer zu vermarkten sind und zum Kostenfaktor werden. Da auch auf der Baustelle, auf der der Flüssigboden eingesetzt wird, große Vorteile entstehen (CO2-Einsparung, geringerer Energieverbrauch) ist dieses neue Standbein ein weiterer Schritt des Unternehmens, den Kreislaufwirtschaftsgedanken umzusetzen, Ressourcen zu sparen und seinen Beitrag zum Umweltschutz zu liefern.
Dank
Die Vertreterinnen der AT MINERAL PROCESSING bedanken sich herzlich für die Möglichkeit der Betriebsbesichtigung und wünschen dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg sowie ein Umdenken der Politik und Wirtschaft hinsichtlich der Verwendung von Recyclingbaustoffen und damit bessere Absatzmöglichkeiten für die RC-Baustoffe. In dieser Hinsicht würde sicher auch die vom Bundesumweltministerium in Aussicht gestellte gesetzliche Regelung zum Ende der Abfalleigenschaft dienen, die vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes als entscheidender Hebel für die vermehrte Verwendung von Recyclingmaterialien betrachtet wird. Es bleibt nicht nur für die Nordmineral zu hoffen, dass eine solche Abfallende-Verordnung bald realisiert wird.
Autoren:
Dr. Brigitte Hoffmann, Consulting Kreislaufwirtschaft/Umweltschutz, Oberschöna/Deutschland
Stefan Becker, Geschäftsführer AMAND Umwelttechnik, Dresden/Deutschland
Literatur:
[1] 14. Monitoring-Bericht zum Aufkommen und Verbleib mineralischer Bau- und Abbruchabfälle. Mitteilung der Initiative Kreislaufwirtschaft vom 06.12.2024
[2] https://www.baumagazin-online.de/d/fifb-neue-wege-im-mineralstoffrecycling/