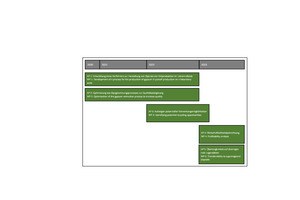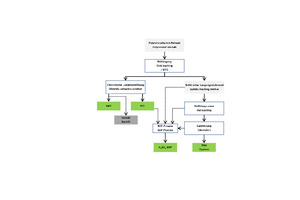Neues Verfahren zur Gewinnung von Gipsprodukten aus dem Kalibergbau
Die Gewinnung von Calciumsulfatprodukten aus dem Kalibergbau kann in Zukunft eine Möglichkeit darstellen, Gips aus einer sekundären Rohstoffquelle zu gewinnen. Die nötigen Grundlagen hierfür werden aktuell im Rahmen des Forschungsvorhabens PolyGips (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Förderprogramm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“) erarbeitet. Die Entwicklung eines Aufbereitungsverfahrens mit anschließender labortechnischer Untersuchung des erzeugten Probenmaterials sind dabei zentraler Bestandteil des Forschungsprojektes. Entscheidend ist die Qualität des hergestellten Gipses, da diese den weiteren Verwertungsweg und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des entwickelten Aufbereitungsprozesses beeinflusst.
1 Einleitung
Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und des damit verbundenen Wegfalls des Gipses aus Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA-Gips) in Deutschland sieht sich die gipsverarbeitende Industrie vor eine große Herausforderung gestellt. Grund hierfür ist, dass in der Vergangenheit bis zu 55 % des deutschen Gipsbedarfes durch REA-Gips gedeckt wurde [1]. Für die sich öffnende „Gipslücke“ müssen Alternativen gefunden werden, um den bestehenden Rohstoffbedarf nicht ausschließlich durch einen gesteigerten Einsatz von Naturgips zu befriedigen. Auch wenn die grundsätzliche Verknappung der...