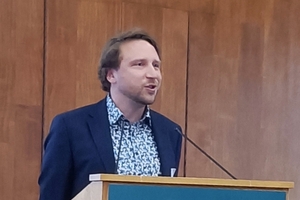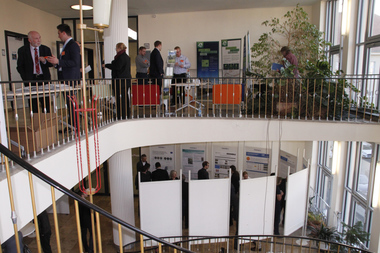70 Jahre außeruniversitäre Aufbereitung und Recycling in Freiberg/Sachsen
Nun schon traditionsgemäß fand auch 2024 – am 07. und 08. November – in Freiberg/Sachs. die von der Gesellschaft für Verfahrenstechnik UVR-FIA e. V. Freiberg veranstaltete Tagung „Aufbereitung und Recycling“ statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der UVR-FIA GmbH in Kooperation mit der TU Bergakademie Freiberg (TU BAF) und dem Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie. Über 100 Fachleute waren der Einladung zu dieser seit Jahren erfolgreichen Veranstaltung gefolgt, um sich über aktuelle Ergebnisse aus Forschung und Anwendung auf diesem Gebiet zu informieren. Zunächst aber hielt Dr.-Ing. Henning Morgenroth, GF der UVR-FIA GmbH Freiberg in seiner Begrüßungsrede Rückschau auf 70 Jahre Aufbereitung und Recycling in Freiberg, denn 1954 wurde das Forschungsinstitut für Aufbereitung der Deutschen Akademie der Wissenschaften, ab 1972 Akademie der Wissenschaften der DDR, gegründet. Ziel dieser Forschungseinrichtung war die Entwicklung von Aufbereitungstechnologien zur Nutzung einheimischer Rohstoffe. Mit oftmals bescheidenen Mitteln, aber hohem Erfindergeist. wurde vor allem vertraglich gebundene Industrieforschung betrieben. Höhepunkt war die dafür vorgesehene Errichtung der „Großen Versuchshalle“ (1958). In der Folge der Auflösung dieser Forschungseinrichtung im Sommer 1990 kam es letztendlich 1996 zur Gründung der UVR-FIA GmbH, die seit 2002 An-Institut der TU BAF ist. Neben Verfahrens- und Prozessgrundlagen werden Untersuchungsmethoden erarbeitet und Maschinen und Apparate im Labormaßstab entwickelt und gebaut sowie Verfahren für Stoffrecycling und Umweltschutz entwickelt.
Abschließend verkündete Dr. Morgenroth, dass seine Geschäftsführertätigkeit zum 31.12.2024 endet und ab 01.01.2025 Dipl.-Ing. Steffen Schmidt diese Position übernimmt (siehe Beitrag AT 01/02, 2025S, S. 4f).
Unter der Thematik „Mineralische Rohstoffe und Wertstoffe aus Abfall“ waren die Schwerpunkte der Tagung
Aufbereitung sekundärer Rohstoffe/Recycling
Maschinen, Apparate und Sensoren
In neunzehn Fachvorträgen wurden neueste Forschungs- und Betriebsergebnisse zu den genannten Schwerpunktthemen vorgestellt, wobei eine klare Zuordnung nicht immer möglich ist.
Beginnend mit der Vorstellung des Freiberger Recyclingunternehmens Feinhütte Halsbrücke AG und seines eigenen Ingenieurbüros POWPRO GmbH, Dresden berichtete Dr.-Ing. Stefan Jäckel über die „Aufbereitung sekundärer feindisperser Hüttenzwischenprodukte“ und stellte die angewandte Vorgehensweise von der Machbarkeitsuntersuchung über das Anlagenkonzept bis hin zur Inbetriebnahme vor. Am Standort Halsbrücke werden qualitativ hochwertige Metalle und Metalllegierungen in mannigfaltigen Zusammensetzungen, Varianten, Formaten und Reinheitsgraden produziert. Die Aufgabe bestand darin, gegenüber der bisherigen Technologie eine energieeffizientere Prozessführung und eine CO2-Einsparung zu realisieren. Zur Optimierung des Ofenprozesses werden nunmehr in einem neuen Misch- und Agglomerationsverfahren die verschiedenen Einsatzstoffe direkt mit dem Reduktionsmittel Koks oder Steinkohle unter Zugabe der Schlackenbildner gemischt und agglomeriert. Der Vortrag vermittelte einen Einblick in die angewandte Verfahrenstechnik und den Projektablauf eines der größten Umweltschutz- und Modernisierungsprojekte der Feinhütte Halsbrücke bis zur Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage im Jahr 2024.
Ein weiteres verfahrenstechnisches Thema behandelte Dr. mont.Karl Friedrich, Montan-Universität Leoben/Österreich mit der „Bewertung von Zerkleinerungsverfahren für Feuerfestausbruchmaterial anhand des Aufschlussgrads von Partikeln < 4 mm“. Untersucht wurden Backenbrecher, Prallmühle, Kegelbrecher und die elektrodynamische Fragmentierung (EDF). Es ist eine Teilaufgabe im EU-Horizon-Projekt „Refractory Sorting Using Revolutionizing Classification Equipment“, durch das die grüne und digitale Transformation der Wertschöpfungskette des Feuerfestrecyclings sichergestellt werden soll. Ziel ist es, die geeignetste Zerkleinerungstechnologie für feuerfeste Steine im Hinblick auf den Aufschlussgrad zu validieren. Als Feuerfestmaterialien wurden MgO-C (Ursprung Stahlpfanne) und gebrannter Magnesia-Hercynit Steine (Ursprung Drehrohrofenausbruch) verwendet.
Die besten Ergebnisse wurden hinsichtlich der Elementanreicherungen (Mg und C für MgO-C, Fe und Al für Magnesia-Hercynit) mit dem Backen- und Kegelbrecher erzielt. Die EDF zeigte für MgO-C kein signifikantes Anreicherungsergebnis, für Magnesia-Hercynit war mit dieser Technologie nahezu keine Zerkleinerung möglich.
Zur „Sortierung strategischer Elemente aus indonesischen Fe-Pb-Zn-(Cu-Ag) -Skarns im Projekt ‚StratOre‘“referierte Frau Dr.-Ing. Özüm Yasar, UVR-FIA GmbH, Freiberg. Nach Vorversuchen im Labormaßstab zur Optimierung der Versuchsparameter erfolgten Pilotversuche an Proben aus den genannten Skarn-Erzen (Galenit, Arsenopyrit, Magnetit, Hämatit, Sphalerit, Chalkopyrit und Calcit). Mittels Herdsortierung und Flotation konnte eine deutliche Anreicherung von Pb, Cu und Zn erzielt werden.
Bauschuttrecycling
Nach wie vor hat das Recycling von Altbaustoffen und Abbruchprodukten schon aufgrund der anfallenden Massen einen hohen Stellenwert, denn trotz hoher Quoten sind noch immer enorme Verbesserungen im Hinblick auf die Verwertung möglich. Mit vier Vorträgen war diese Thematik auf der Tagung vertreten. Dr.-Ing. Pierre Landgraf, TU BAF, trug die Ergebnisse eines Autorenkollegiums zum „Betonrecycling: Mechanische und elektrodynamische Zerkleinerung (EDF) von Altbeton“ vor. Ziel des Projektes ist es, weg vom sog. Downcycling (Einsatz von Altbeton beispielsweise im Straßenunterbau) hin zum Upcycling zu gelangen. Dazu ist die effiziente Trennung der einzelnen Betonbestandteile (Kies, Sand, Zementstein) erforderlich, um diese dann als Sekundärrohstoffe wieder im Produktionsprozess einsetzen zu können. Im Rahmen dieses sog. Up-Zement-Projektes erfolgte die EDF-Behandlung des Altmaterials, die zur Schwächung entlang der Korn- und Phasengrenzen und zum Aufschluss in die verschiedenen Bestandteile führt. Anschließend ist eine mechanische Zerkleinerung in Wälzmühlen vorgesehen, dafür stehen 20 t Betonbrückenabbruch aus Aachen als Untersuchungsmaterial zur Verfügung.
Ein anderes Upcycling-Projekt stellte Frau Dr.-Ing. Anett Lipowsky, IAB – Institut für Angewandte Bauforschung gGmbH, Weimar, vor. In ihrem Vortrag „Sortierung und Aktivierung von feinkörnigem Bauschutt“ stand die Gewinnung von feinkörnigem Ziegelmehl aus Ziegel-Mörtel-Beton-Gemisch als Ersatzstoff für Zement im Fokus. Aber auch bisher ungenutzte Gesteinsfüller wie Rhyolith, Grauwacke oder Basalt aus Abraumhalden von Steinbrüchen wurden in die Untersuchungen zum Einsatz als mögliche Zementsubstitute im Ausgangszustand bzw. nach einer weiteren Aufbereitung bzw. Behandlung einbezogen. Die Abtrennung der Ziegelpartikel aus dem Mauerwerkbruch erfolgte mittels RER-Magnetscheider (Rare Earth Roll Separator mit Nd-Fe-B-Magneten). Durch Einsatz verschiedener Zerkleinerungsaggregate (Kugel- sowie Planetenkugelmühle, auch unter Zugabe von Mahlhilfsmitteln, Schockwellenzerkleinerung) konnten entsprechende Aktivierungseffekte erzielt werden, so dass vor allem Ziegelmehle als Zementersatzstoff Anwendung finden könnten.
Zwei Vorträge zur Anwendung der Ersatzbaustoffverordnung ergänzten den Vortragsblock, die explizit die in anderen Veranstaltungen bereits viel diskutierten Hürden dieser Verordnung vor allem bei ihrer Umsetzung zur Disposition stellten (Güteüberwachung, Eignungsnachweise, analytischer Aufwand).
Ressourceneffizienz
Die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen bei gleichzeitiger Minimierung ihrer Auswirkung auf die Umwelt, schlechthin eben Ressourceneffizienz, ist nicht nur ein heute viel gebrauchtes Schlagwort, sondern im Sinne der nachhaltigen Nutzung der begrenzten Ressourcen unserer Erde eine unumgängliche Notwendigkeit, der auch auf dieser Tagung mit vier Vorträgen Nachdruck verliehen wurde.
Mit Blick auf die Energiewende berichtete Vadim Greshnow, ERCOSPLAN Ingenieurbüro Anlagentechnik GmbH, Erfurt über das „Potenzial und (die) Bedeutung des NaCl-Recyclings aus Rückständen der Kaliindustrie“.
Aus dem großen Portfolio der HAVER & BOECKER GmbH, Freiberg zum Recycling von Schlacken, Stäuben und Schlämmen stellte Dr.-Ing. Jan Lampke, einige Praxisbeispiel vor, die sich den Rahmenbedingungen, die bei der Prozessentwicklung und Projektierung sowie dem Bau, der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Brech- und Klassieranlagen für Schlacken der NE-Metallurgie zu berücksichtigen sind (Beispiele: Europas größte Siebmaschine in einer Recyclinganlage, Brech- und Klassieranlagen zur selektiven Zerkleinerung und Separation von spröden Schlacken mit duktilen Kupferbestandteilen). Der Referent betonte, dass die Konzepte des Recyclings, der Circular Economy, des Waste-to-Value-Ansatzes sowie des Green Deals keine neuartigen, komplexen Verfahren sind, sondern seit jeher integraler Bestandteil der Arbeit von Aufbereitern und somit das Vorgehen der Ressourceneffizienz dient.
Neues aus dem Maschinen- und Anlagenbau
Nicht nur Maschinenverbesserungen und Neuentwicklungen von Maschinen und Anlagen, sondern auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) bereicherten in diesem Block das Vortragsprogramm.
So referierte beispielsweise Johannes Müller, Köppern Aufbereitungs GmbH & Co. KG, Freiberg, über „KI zur Untersuchung von Zerkleinerungsanlagen in der Zementindustrie". Zu dieser Thematik gehörte auch ein Vortrag aus dem nächsten Themenblock, bei dem M.Sc. Adrian Valenas, TU BAF, Freiberg „Untersuchungen zur sensorgestützten Sortierung von mit Messing verunreinigten Al-Konzentraten über KI-gestützte Bilderkennung“ vorstellte, die vor allem für die Automobilindustrieindustrie von großem Interesse sind. Für die Validierung der sortierten Produkte wurde das Yolo-Modell für die Bilderkennung verwendet, das mit ca. 1000 Bildern „trainiert“ und auf diese Weise optimiert wurde. Unter kontrollierten Bedingungen wurde eine hohe Erkennungs- und Sortiergenauigkeit erzielt.
„Neuentwicklungen eines Stachelwalzenprofils für den Jehmlich-Walzenbrecher“ standen im Vortrag von Raphael Sperberg, Gebrüder Jehmlich GmbH, Nossen zur Diskussion. Diese Maschine ist vor allem für klumpende Materialien wie z. B. Kaoline geeignet. Im Vortrag wurde der Einsatz bei der Zerkleinerung von Krokantplatten vorgestellt.
Mit der kryogenen Vermahlung beschäftigte sich Luca Nivelstein, NEUMANN ESSER Process Technologie GmbH, Übach-Palenberg und stellte die entsprechende Maschine NEA Cryo X vor, mit der eine hohe Effizienzsteigerung bei der Zerkleinerung weicher, flexibler und feuchter Materialen erzielt werden kann. Der Referent vermittelte technische Details aus dem Entwicklungsprozess und Betriebserfahrungen mit diesem Anlagenteil, das auch in konventionellen Kryogene-Mahlanlagen zur Effizienzsteigerung einsetzbar ist.
Innovatives aus dem Recyclingbereich
Welche Vielfalt an Möglichkeiten für die Aufbereitung von Reststoffen im Sinne der Nachhaltigkeit besteht, zeigten die im Mittelpunkt der Vorträge dieses Themenblocks stehenden Projekte. Nicht immer sind es Massenabfälle, deren Verwertung zu hohen ökonomischen Ergebnissen führen. Im Sinne einer allumfassenden Kreislaufwirtschaft sind aber auch sog. Nischen-Recyclingprodukte nicht zu unterschätzen.
Zunächst stellte M.Eng. Markus Kammer, Hochschule Hannover, IfBB Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe, die Kompetenzbereiche des Instituts vor und widmete sich dann dem eigentlichen Vortragsthema „Multifunktionales Additiv aus Eierschalen für die Kunststoffindustrie“ (Projekt ADD Egg). Immerhin fallen in Europa etwa 720 kt/a an, die bisher nur unzureichend genutzt wurden und entgeltlich entsorgt werden müssen. Dabei sind Eierschalen mit einem CaCO3-Anteil von 93 % prädestiniert, um als Füllstoff, als Nukleierungsmittel oder zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit in der Kunststoffindustrie Verwendung zu finden. Auf der Grundlage dieser Überlegungen wurden kleintechnische Untersuchungen mit 25 – 40 Gew.-% Eierschalen in PP und PA durchgeführt und positive Ergebnisse erhalten. Die Arbeiten sollen in einem neuen Projekt (Tec4Egg) mit weiteren Partnern in größerem Maßstab fortgeführt werden.
Über ein weiteres, sehr spezielles Thema: „Recycling von Kunststoffrasen“ berichtete Robert Clausnitzer, AKW Apparate + Verfahren GmbH, Hirschau in seinem Beitrag „Nachhaltiges Sportplatz-Recycling: Innovative Lösungen für eine grüne Zukunft“. Auch dieser Abfall wird bisher höchstens thermisch verwertet oder auf Deponien zwischengelagert. Immerhin gibt es in Deutschland 6000 Kunstrasenplätze und 45 000 entsprechende Sportplätze (Europa: 30 000 resp. 70 000). von denen derzeit nur 10 – 20 % verwertet werden. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wurde ein einzigartiges Konzept entwickelt und im Pilotmaßstab erprobt, mit dem Sportplatzrückstände, wie Sand, Gummigranulat und Fasern, nach dem Schreddern und Zerkleinern auf geeignete ökologische und wirtschaftliche Weise aufbereitet werden können. Die auf diesen Ergebnissen basierende semi-mobile und mit einer Aufgabekapazität > 10 t/h ausgelegte Anlage, die mit einem Durchsatz von 13,5 t/h seit 2 Jahren im Einsatz ist, wurde vorgestellt.
Im letzten Vortrag präsentierte Frau Dip.-Ing. Alexandra Kaas, TU BAF Freiberg, eine Übersicht über die Arbeiten zur mechanischen Aufbereitung von Li-Ionen-Batterien am Institut für mechanische Verfahrenstechnik/Aufbereitungstechnik. Seit etlichen Jahren beschäftigt man sich erfolgreich an diesem Institut mit der schwierigen Problematik, deren Ziel die ökonomische Gewinnung der Wertmetalle bzw. Produkte vor allem Al, Cu, Schwarzmasse, Anodenmaterial und Kathodenfolie ist. Neben der sachgerechten Entladung der Batterien kommt der mechanischen Aufschlusszerkleinerung derselben und der anschließenden Sortierung in die Einzelkomponenten eine Schlüsselrolle zu. Schwerpunkt der Arbeiten ist die Erzielung einer hohen Qualität der Schwarzmasse in Abhängigkeit von der Vorbehandlung wie z. B. der Ladungszustand oder die thermische Vorbehandlung sowie von unterschiedlichen Batterietypen auf den Prozess.
Resümee
Die Tagung „Aufbereitung und Recycling“ zeigte wiederum die Vielseitigkeit und Wichtigkeit der Aufbereitung bzw. Verfahrenstechnik für die Gewinnung von Recyclingprodukten und damit für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Immer wieder gibt es innovative Lösungsansätze, die zu positiven Ergebnissen führen. Dabei zeichnet sich diese Freiberger Tagung vor allem dadurch aus, dass anwendungstechnische, zum Teil schon industriell erprobte Forschungsarbeiten vorgestellt werden.
Begrüßenswert war, dass die Autoren, meist junge Wissenschaftler der zehn ausgestellten Poster die Möglichkeit erhielten, in einem Kurzvortrag ihre dargestellten Arbeiten zu präsentieren. Bei der Abendveranstaltung am ersten Konferenztag und in den Vortragspausen ergaben sich ausreichende Möglichkeiten zum Gedankenaustausch und Kennenlernen. Die Organisation war ausgezeichnet und dafür bedankte sich auch Dr. Morgenroth in seinem Schlusswort ausdrücklich bei dem Veranstalter. Gleichzeitig verkündete er den Termin für die folgende Tagung, die für den 06. und 07. November 2025 geplant ist.
Autorin:
Dr. Brigitte Hoffmann, Consulting Kreislaufwirtschaft/Umweltschutz
Oberschöna/Deutschland